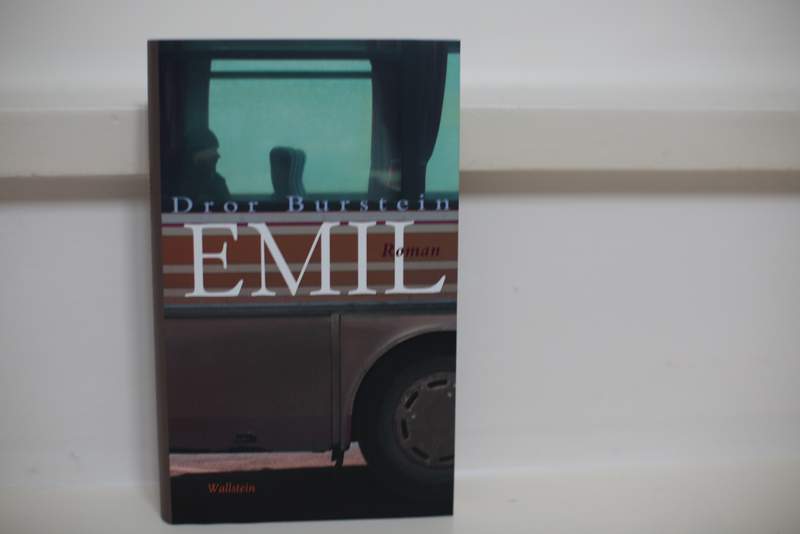Emil ist adoptiert. Aus dem großen weißen Haus, in dem viele klitzekleinen Kinder warten. Jetzt, gerade in diesem Augenblick, wissen lea und ihr Mann, dass dieser kleine Bub der richtige für sie ist. Sie adoptieren ihn und beobachten ihn. Gern würde man länger bei ihnen bleiben, doch schon reißt einen der Autor weiter in andre Räume, hin zu den leiblichen Eltern des Buben. Sechzehn waren sie beide. Also immer raus aus den Häusern und Lokalen, den Orten, von denen erzählt wird und den Zeiten, um die es gerade geht. Die beiden also, die mit dem Rauchen aufhören wollen und denen die weiß getünchten Wände den alten Teer entgegenhusten. Kein Neuanfang? Keine Änderung? Emil, das Kind arabischer Eltern, wird von Juden adoptiert, großgezogen. Der Titel des Buch lautet im Original „verwandt“ und benennt somit das große Thema und wohl auch das Tabu, um das der Text kreist. Lea und Joel erkennen, dass die Leute auf den Straßen deutlich erkennen, dass sie, die hellhäutigen Juden, Aschkenasi, Juden mit europäischen Wurzeln, wohl niemals die leiblichen Eltern des jungen mit dem dunklen Teint und Haaren sein können. Nur einmal färbt sich Joel nach einer solchen Begegnung – sie erregen zweifelsohne Aufsehen – die Haare dunkel, rasiert sich daraufhin wie ein Besessener, weil seine hellen Bartstoppeln ihn doch immer verraten hätten.
Die Kinder zeigten auf ihn, und die Eltern beugten sich erklärend zu ihnen herab. Nein, nicht mit dem Finger zeigen.
Die Kleinfamilie beginnt ihre Rituale, der missglückte Kuchen mit der Schokoglasur landet im Müll, der Bootsausflug hingegen gelingt. Nach Leas Tod – sie stirbt bei einem Unfall – wird die Bindung Emils an Joel noch inniger und umgekehrt genauso. Die Adoption ist das Verbindende, das Verschwiegene, das Tabu ist ein wichtiger Klebstoff und der Plot dieser auf viele Erzählstränge aufgeteilten Geschichte. Wieder zurück zu den leiblichen Eltern: Jetzt ist es der alte, über 70 Jahre alte Joel, der sie für ihren Sohn sucht und findet. Wer diesen Erzählfäden folgt, fährt und geht durch die Straßen von Tel Aviv, fährt und reist durch die Zeit. Im arabischen Jaffa wird Emil geboren, vor dessen Toren haben die zionistischen Pioniere einst Tel Aviv gegründet. Emil muss zum Wehrdienst, Joel ist überzeugt davon, dass er im Ernstfall auf Araber schießen würde: Herkunft, Adoption, Familie, soziale und leibliche Elternschaft sind an sich große Themen. Hier bekommen sie Seite für Seite eine tiefe politische Dimension, die Geschichte der Familie wird mit der Politik und der Geschichte des Landes verwoben, Trennungen und Risse, Verbindendes und Trennendes sind in Details spürbar. Der Alte, dem jungen nacheilt, die Frau, die sich doch ein Mädchen wünschte und dann doch Emil adoptierte – eine Geschichte, die sich nicht chronologisch erzählen lassen will.
Was Sie versäumen, wenn Sie das Buch nicht lesen: große Gefühle, Zugänge zu Israel, zu einer Stadt wie Tel Aviv, zu Verkehrsmitteln, zu Einsamkeiten, zu Paardiskussionen, zu Elternschaft und zu Heimat. Vielleicht einfach zu Identität.
Der Autor, Jahrgang 1970, zählt zu den bekanntesten Schriftstellern Israels. So wurde er u. a. auch mit dem Jerusalemer Literaturpreis ausgezeichnet. „Emil“ ist sin erster auf Deutsch erschienener Roman.
Dror Burstein:
Emil. Roman.
Aus dem Hebräischen von Liliane Meilinger.
Göttingen: Wallstein 2014.