Mädchen, die überfordert sind, keinen Antrieb verspüren, Angst vor der Wirklichkeit haben, mutlos sind. Der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Schulte-Markwort erzählt davon, wie er das Phänomen der „mutlosen Mädchen“ entdeckte, was dahintersteckt – und wo möglicherweise eine Lösung liegt.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass das Phänomen der „mutlosen Mädchen“ sich Ihnen schleichend offenbart hat. Was haben Sie beobachtet?
Wir beobachteten Mädchen, die in ihrer Entwicklung nicht so richtig weiterkommen, Mädchen, die depressiv werden, Mädchen, die sich zurückziehen. Für unsere klinische Arbeit ist das an sich kein neues Phänomen und wir sehen es auch bei Jungen. Was neu war: dass meine KollegInnen und ich den Eindruck teilten, dass unsere therapeutischen Maßnahmen nicht wirklich greifen konnten. Dass antidepressive Medikation und auch das, was man sonst bei Depressionen macht – Strukturierung Aktivierung – diesen Mädchen nicht half. Sie haben uns ratlos gemacht!
„Mutlosigkeit ist etwas, das eigentlich gegen jede pubertäre Struktur gebürstet ist. Sie kommt in dem Alter eigentlich nicht vor, zumindest nicht durchgängig. “
Mutlosigkeit, die sie in der Form also bisher nicht beobachtet hatten?
Ich habe immer Angst davor, Zeitgeistverschiebungen in der kindlichen Psychopathologie zu übersehen, sozusagen psychiatrisch zu verkrusten und immer beim gleichen Klassifikationsschema zu bleiben. Deshalb versuche ich, besonders aufmerksam zu sein. Eines Tages wurde mir bewusst, dass es eine eigene Gruppe von Mädchen gibt, die eine eigene Identität darstellen und etwas Besonderes sind. Und dass diese Gruppe größer wird. Das hat mich so sehr beschäftigt, dass ich es zwar nicht als neue Krankheit im eigentlichen Sinne, wohl aber als neues Phänomen betrachtete.
Die Mädchen sind alle im pubertären Alter?
Ja. Und Mutlosigkeit ist etwas, das eigentlich gegen jede pubertäre Struktur gebürstet ist. Sie kommt in dem Alter eigentlich nicht vor, zumindest nicht durchgängig. Parallel dazu habe ich in einer lange bestehenden therapeutischen Müttergruppe erlebt, wie erschöpft die Mütter sind. Das hat mich zusätzlich zum Nachdenken gebracht. Und so bin ich auf die „mutlosen Mädchen“ gekommen.
Von welchen Dimensionen sprechen wir?
Unter den Mädchen, die ich in meiner Praxis beobachte, sind es etwa fünf Prozent.
Wie viele sind das im Vergleich zu Jugendlichen mit Depressionen?
Ich würde sagen, es sind etwa 10 Prozent der Jugendlichen mit Depressionen. Dies basiert aber vorerst auf unseren Beobachtungen, nicht auf wissenschaftlich erhobenen Zahlen.
„Das sind Mädchen, die vor einem sitzen, die Achseln zucken und sagen: ‚Mich lockt nichts. Ich finde da draußen nichts spannend, du kannst mir zeigen, was du willst.‘“
In Ihrem Buch beschreiben sie einige Fallbeispiele von Mädchen. Sie alle kamen wegen Depressionen zu Ihnen. Wie grenzt man Mutlosigkeit von Depressionen ab?
Im Wesentlichen liegt die Unterscheidung darin, dass die „mutlosen Mädchen“ nicht wirklich einen depressiven Affekt spüren, nicht diese tiefe Traurigkeit. Da ist Antriebslosigkeit und das, wofür mir immer nur wieder dieses Wort einfällt: Mutlosigkeit. Das ist etwas anderes als Traurigkeit. Es kann zu Traurigkeit führen, aber das ist nicht der primäre Affekt.
Womit haben wir es also konkret zu tun? Die Mädchen sind mutlos. Aber wie äußert sich das?
Darin, dass sie sich stückweise von der Welt zurückziehen. Das sind Mädchen, die vor einem sitzen, die Achseln zucken und sagen: „Mich lockt nichts. Ich finde da draußen nichts spannend, du kannst mir zeigen, was du willst.“ Manche sagen sogar: „Die Welt da draußen macht mir Angst.“ Ein entscheidender Punkt in dieser Entwicklung ist dann, ob sie die Schule noch schaffen oder nicht. Wenn sie aufhören zur Schule zu gehen, wird die Schwelle, wieder hinzugehen, jeden Tag höher und irgendwann klappt das Leben immer weniger.
Welche Rolle spielt denn die Schule in all dem? Und welche sollte sie spielen?
Schule ist sozusagen der zentrale Alltag von Kindern und Jugendlichen. Sie verbindet das soziale Leben und die kognitiven Anforderungen – hoffentlich optimal – miteinander. Die „mutlosen Mädchen“ nehmen es aber als täglichen „Catwalk“ wahr und in diesem sozialen Gefüge haben sie das Gefühl, nicht mehr zu bestehen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es sie nicht lockt. Es ist für sie nicht mehr interessant, mit anderen zusammen zu sein. Dazu kommt, dass sie sich auch selber abwerten, davon ausgehen, sie können nicht mehr lernen und massive Konzentrationsprobleme bekommen.
Beim Lesen Ihres Buches fragt man sich unweigerlich, wer denn daran schuld sein könnte. Wen oder was haben Sie im Visier?
Es ist ein Zusammenspiel vieler Faktoren. Wenn wir versuchen, sie alle zu verdichten, würde ich sagen, dass diese Mädchen uns darauf hinweisen, dass siebzig Jahre emanzipatorische Entwicklung gescheitert sind. Und dass die Gewinner der Emanzipation die Jungs und die Männer sind.
„Die Emanzipation der Frauen ist uns nur im Leistungsbereich, in der Karriere gelungen.“
Das ist hart.
Ja, das ist hart. Das finde ich auch. Das ist auch das, was mich daran so umtreibt. Wenn ein junger Mann heute sagt, dass er Hausmann werden möchte, bekommt er dafür Anerkennung. Egal, ob er beschließt, knallharter Businessmann oder einfühlsamer Familienvater zu werden. Ein junges Mädchen kann nicht mehr sagen, es möchte ausschließlich Mutter und Hausfrau werden, ohne geringschätzig angeschaut zu werden. Denn die Emanzipation der Frauen ist uns nur im Leistungsbereich, in der Karriere gelungen – da feiern wir sie und finden, dass Frauen alle Möglichkeiten haben sollten, zahlen sie aber schlechter. Ich finde das richtig dramatisch. Und ich habe den Eindruck, dass die „mutlosen Mädchen“ den Finger in die Wunde legen, indem sie sagen: „Meine Mutter hat drei Jobs auf einmal, sie gibt alles und ist völlig erschöpft – und das ist kein Modell für mich.“ Sie sehen darin keinen Lebensentwurf für sich. Und es ist es ja unmittelbar nachvollziehbar, dass das mutlos macht.
Wie reagieren denn die Mütter auf die „Diagnose“?
Meist sehr verängstigt. Weil sie eben wirklich alles geben und sich sehr anstrengen. Und dann die Tochter plötzlich sagt: „Ich will das nicht.“ Diese Mütter sind daran gewöhnt, Vorschläge zu erarbeiten und mit diesen Vorschlägen bedrängen sie dann, gut gemeint, die Töchter, die sich nur noch mehr zurückziehen. Und dann ist da vielleicht noch ein erfolgreicher Vater, der überhaupt nichts mehr versteht. Daraus resultiert dann eine Mischung aus Verweigerung und Verwirrung darüber, was eigentlich los ist. Eltern kommen relativ schnell an eine kaum auszuhaltende Hilflosigkeit, die wir TherapeutInnen auch spüren.
Sie schreiben auch, dass die geschlechtsspezifischen Rollen, die Mütter und Väter in der frühkindlichen Phase einnehmen, gesellschaftlich nicht anerkannt werden. Haben wir uns etwa selbst ein Ei gelegt, indem wir uns weigern, uns auf unser Geschlecht reduzieren zu lassen?
Ich sage immer: Vaterschaft beginnt mit einer Beziehung, Mutterschaft neun Monate früher. Diese neun Monate sind aber entscheidend, die kann ein Vater auch niemals aufholen. Und viele Väter ziehen sich dahinter auch zurück. Daraus resultiert, was alle jungen Mütter kennen: nämlich, dass alles sehr anstrengend ist. Und dass sie gar nicht drum herumkommen, erschöpft zu sein. Diese Erschöpfung wird nicht anerkannt. Viele junge Mütter werden bestätigen, dass sie einen Druck verspüren, nicht sagen zu dürfen, wie anstrengend das alles ist.
Sie erzählen die Fallbeispiele am Ende Ihres Buches weiter – und wirklich positiv gestimmt lassen diese die LeserInnen nicht zurück. Man hat den Eindruck, es gibt eigentlich keine Lösung.
Das ist genau der Punkt. Die Kunst liegt darin, anzuerkennen, dass es nicht weitergeht. Das gibt es in der Medizin ja manchmal. Vor ein paar Tagen erst habe ich mit einem Kollegen diskutiert, ob wir nicht einen Begriff wie „palliative Kinder- und Jugendpsychiatrie“ einführen sollten. Das ist zwar etwas stark übertrieben, weil es bei uns nicht um den Tod geht. Aber es geht um einen Stillstand. Und in diesem Stillstand bringt es nichts, aktionistisch zu werden, weil die Mädchen darauf mit Gegenwehr reagieren. Das war im Übrigen auch der Grund für mich, dieses Buch zu schreiben. Ich wollte keine Lösung präsentieren, sondern ich wollte, dass wir etwas diskutieren.
Wie ist diese Diskussion bisher gelaufen?
Die meisten meiner KollegInnen sagen: „Ja, stimmt, ich sehe diese Mädchen auch und habe das bisher immer als Depression eingeordnet. Vielleicht sollte ich mir mehr Gedanken dazu machen.“ Ich bekomme sehr viel Zuschriften von Müttern und auch Töchtern, die sehr berührt sind und sagen: „Endlich versteht jemand, was los ist.“ Es gibt viele JournalistInnen, die sich dafür interessieren und den emotionalen Gehalt davon transportieren wollen. Es gibt aber auch jene, die sagen: „Herr Schulte-Markwort behauptet, dass die berufstätigen Frauen schuld daran sind, dass die Kinder krank werden.“ Das sage ich aber überhaupt nicht. So einfach ist es nicht.
„Ich denke, es geht darum, dass Mütter noch einmal intensiv mit Vätern über die Aufteilung der familiären Arbeit sprechen sollten. Und ich denke, dass sich Mütter auch mit ihrem Perfektionismus auseinandersetzen müssen.“
Sie haben einige vermutete Lösungsansätze, bei den meisten geht es um Raum und Vertrauen und um einfach Seinlassen. Ist das vielleicht die schwierigste Übung überhaupt?
Absolut. Weil es ja ganz und gar nicht in unsere Gesellschaft passt und weil es zwei Entwicklungen gibt, die für Eltern – und insbesondere für Mütter – schwer auszuhalten sind: Wenn ein Kind aufhört zu essen oder wenn ein Kind sich nicht mehr weiterentwickelt. Die schlimmste „Diagnose“, die ich Eltern mitteilen kann, ist: „Ihr Kind ist lernbehindert.“ Das ist für sie, als würde ich sagen, das Kind hätte keine Lebenschancen mehr. So leistungsorientiert sind wir. Und wenn dann ein Kind nicht mehr zur Schule gehen will – obwohl man ihm die beste Schule zur Verfügung stellt –, fühlt sich das wie Verrat an. Das zieht den Eltern den Boden unter den Füßen weg.
Welche Stoßrichtung verfolgen Sie also in der psychologischen Praxis?
Für mich ist die Stoßrichtung die, dass wir einmal mehr darüber nachdenken, ob wir allen psychopathologischen Phänomenen und Veränderungen gerecht werden. Wie müssen wir uns darauf einstellen? Ich bin überhaupt kein Pessimist, weder als Mensch noch als Therapeut. Und in den teilweise fünf Jahren, in denen ich diese Mädchen betreue, habe ich gemerkt, dass es doch Mikro-Fortschritte gibt. Wenn ich die ganze Palette von „Ich verstehe dich, ich lass dir Zeit“ über „Ich finde, du verweigerst hier etwas, obwohl du es aufnehmen könntest“ bis zu „Was gibt es denn, das dich locken könnte?“ bearbeite, dann geht es irgendwann doch in kleinen Schritten weiter.
Was ist mit uns Müttern? Was können wir tun?
Ich denke, es geht darum, dass Mütter noch einmal intensiv mit Vätern über die Aufteilung der familiären Arbeit sprechen sollten. Und ich denke, dass sich Mütter auch mit ihrem Perfektionismus auseinandersetzen müssen. Wenn meine Hypothese über die falsch gelaufene Emanzipation stimmt, sollten Frauen dazu eine Position einnehmen.
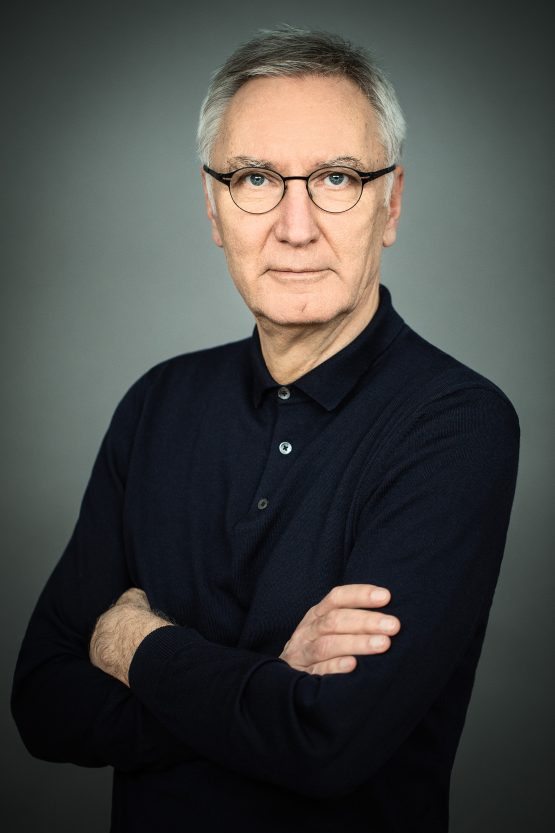
Zur Person:
Michael Schulte-Markwort ist einer der renommiertesten deutschen Kinder- und Jugendpsychiater und Experte für Kinderseelen. Er ist als ärztlicher Direktor der Oberberg Fachklinik „Marzipanfabrik“ und in seinen Privatpraxen „Paidion- Heilkunde für Kinderseelen“ in Hamburg und Berlin tätig. In seinem Buch „Mutlose Mädchen“ beschreibt er, dass immer mehr Mädchen ihre Umwelt als überfordernd und bedrohlich wahrnehmen.

Buchtipp:
Michael Schulte-Markwort:
Mutlose Mädchen.
Ein neues Phänomen besser verstehen.
Kösel Verlag,
23,50 Euro









