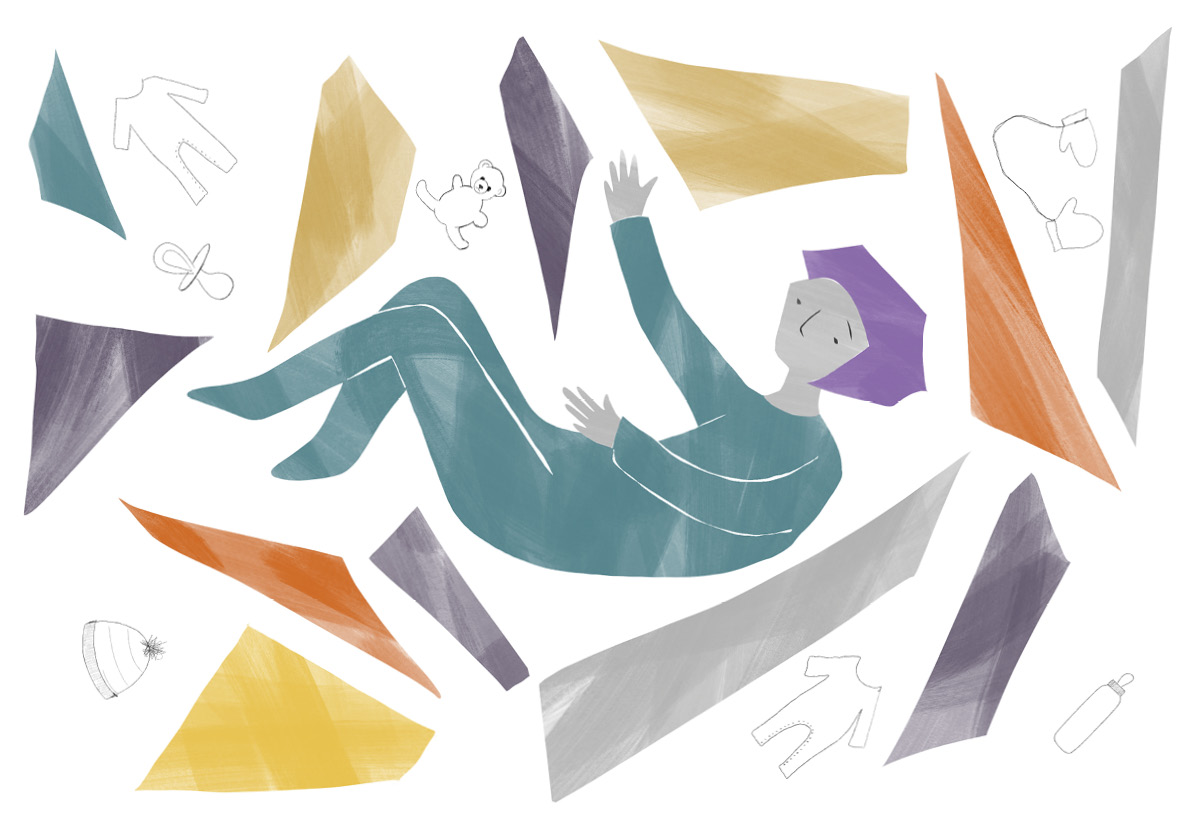Wenn nach der Geburt eines Kindes die Glücksgefühle ausbleiben und sich stattdessen eine postpartale Depression wie eine dunkle Wolke über das Mutterglück legt, ist rasche Hilfe wichtig. Doch die ist gar nicht so einfach zu bekommen. Recherche zu einem oft verschwiegenen Problem.
Sie hatte sich sehr auf ihre Tochter gefreut. Antonia, ihr viertes Kind und ihre erste Tochter, war ein Wunschkind. Mit der Geburt ihres ersten Sohnes hatte Renate Grünstäudl (40), eine diplomierte Krankenschwester, ihren Beruf aufgegeben, um ihren Mann in der Landwirtschaft zu unterstützen. Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes hatte sie einen sehr heftigen Babyblues. „Ich schlief schlecht, war unruhig, und das Leben fühlte sich schwer an.“ Die Symptome minderten sich nach zwei Wochen von selbst. Beim dritten Kind gab es keine Probleme.
Doch als ihre Viertgeborene, Antonia, zwei Wochen alt war, spürte Grünstäudl, dass „dieses Gefühl wiederkommt“. Um es rasch zum Verschwinden zu bringen, ging sie zu einer Psychiaterin und bekam ein „Notfallmedikament“. Doch die Symptome verschwanden nicht. Im Gegenteil: Sie wurden heftiger. Als die kleine Tochter drei Wochen alt war, bekam Renate Grünstäudl eine Panikattacke: „Ich wollte Antonia ins Bett bringen, doch sie hat die ganze Zeit geschrien. Irgendwann habe ich nur noch geweint.“
BABYBLUES ODER DEPRESSION?
Auf 15 bis 20 Prozent wird der Anteil der Mütter geschätzt, die nach der Geburt unter einer postpartalen Depression (PPD) leiden. Tendenz steigend. Die PPD ist nicht zu verwechseln mit dem Babyblues, dem hormonell bedingten Stimmungstief, in das viele Mütter wenige Tage nach der Geburt fallen. Die Wochenbettdepression ist eine ernst zu nehmende Erkrankung, die sich, wenn sie nicht behandelt wird, chronifizieren kann und ein Risiko für das Kind darstellt. Sie tritt innerhalb des ersten Jahres nach der Geburt auf, das kann nach drei Monaten sein oder erst nach sechs. Die Symptome reichen von trauriger Verstimmtheit, Antriebslosigkeit und Erschöpfung, Angstzuständen, Zwangsgedanken, Schlaflosigkeit und Appetitstörungen bis hin zu Suizidgedanken.
Ungefähr ein Drittel der Frauen, die an einer postpartalen Depression erkranken, entwickeln auch eine Bindungsstörung. Sie empfinden nichts für ihr Kind, wollen nicht mit ihm zusammen sein und sind froh, wenn es jemand anders versorgt. Sie fühlen sich „ausgesaugt“, fürchten sich teilweise vor dem Kind und haben negative Fantasien ihm gegenüber, im schlimmsten Fall sogar Tötungsfantasien.
„Auch die Psyche sollte gescreent werden“
Fast jede fünfte Mutter erkrankt an einer postpartalen Depression. Was sind die Gründe dafür?
Renate Mitterhuber: Zum einen haben viele Frauen eine hohe Erwartungshaltung an das Leben mit Kind, die sich selten erfüllt. Zum anderen ist auch unser individualisierter Lebensstil ein Grund. Viele Mütter sind auf sich alleine gestellt, es gibt keine Oma, die hilft, und keine Wochenbettkultur, in der die Frau während des Wochenbetts umsorgt wird. Ich empfehle den Frauen: Damit es beim ersten Kind gut läuft, brauchen sie mindestens sechs Wochen eine gute Begleitung und Unterstützung. Eine postpartale Depression hat in vielen Fällen damit zu tun, dass zu wenig Unterstützung organisiert beziehungsweise angenommen wird.
Sie haben das „Netzwerk perinatale Krisen“ mit aufgebaut. Was ist bereits geschehen?
Wir haben Fortbildungsmaßnahmen zum besseren Erkennen einer postpartalen Depression eingeleitet; wir haben den EPDS-Fragebogen (siehe S. 62) an Geburtsstationen etabliert und Informationsbroschüren erstellt, die in jeder Schwangerenambulanz in Wien aufliegen sollten. Leider kommt die Information
oft nicht bei den Frauen an. Auch von Gynäkologen und Kinderärzten wird das Thema zu wenig ernst genommen.
Was wünschen Sie sich?
Die psychische Situation gehört dringend als Vermerk in den Mutter-Kind-Pass. Jede Schwangere muss den Zuckerbelastungstest machen; dabei sind psychische Erkrankungen viel häufiger als Schwangerschaftsdiabetes. Perinatale Krisen sollten auch ein Schwerpunkt in der Geburtsvorbereitung sein. In Deutschland können Frauen bis zu ein Jahr von der Hebamme betreut werden – das wünschen wir uns auch für Österreich. Es bräuchte mehr stationäre Einrichtungen mit interdisziplinärem Therapieangebot, in die Mütter mit ihren Kindern aufgenommen werden können.

Renate Mitterhuber ist seit 40 Jahren Hebamme und engagiert sich im „Netzwerk perinatale Krisen“ in Wien.
„Ich hatte das Gefühl, nicht mehr ich selbst zu sein“
Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes stürzte Ulrike Schrimpf in eine postpartale Depression. Ein Gespräch über ihren Weg aus der Krankheit und ihren Mut zum dritten Kind.
Welche Symptome einer postpartalen Depression hatten Sie?
Ulrike Schrimpf: Ich entwickelte eine ganz große Nervosität, ich stand immer unter Strom, hatte Ängste. Aber das Schlimmste waren die schlaflosen Nächte. Ich hatte das Gefühl, nicht mehr ich selbst zu sein.
Wann und wie hat die Krankheit begonnen?
Angefangen hat es schon in der Schwangerschaft. Ich hatte Angst, Blutungen zu bekommen und mein Baby zu verlieren. Bevor ich zum zweiten Mal schwanger wurde, hatte ich einen Abgang. Ich habe auch öfter nicht gut geschlafen. Ich dachte, das hängt mit dem Umzug von Berlin nach Wien zusammen. Wir sind eine Patchworkfamilie, da war alles sehr aufregend. Die Depression baute sich langsam auf und steigerte sich, bis ich sie nicht mehr alleine bewältigen konnte. Als mein Sohn zehn Wochen alt war, bin ich ins Krankenhaus gegangen.
Etwa ein Drittel aller postpartalen Depressionen wird weder erkannt noch behandelt. Wie konnten Sie sicher sein, dass es sich darum handelte?
Ich war mir gar nicht sicher. Ich dachte immer, das betreffe doch die Mütter, die ihre Kinder nicht annehmen und lieben können. Bei fast jeder dritten Frau liegt auch eine Bindungsstörung vor, bei mir war das aber nicht so. Als ich im Krankenhaus einen Evaluierungsbogen ausfüllen musste, hab ich gedacht: „Ich muss jetzt so tun, als hätte ich diese Bindungsstörung, sonst schicken sie mich wieder nach Hause.“ Ich hatte Glück, eines der vier Betten in Wien zur stationären Behandlung zu bekommen, gemeinsam mit meinem Kind.
Wie lässt sich Ihre Erkrankung zeitlich einordnen?
Wir waren insgesamt drei Wochen im Krankenhaus. Ich kann mich erinnern, dass ich nach zehn Tagen im Spital zu meiner Mutter gesagt habe: „Jetzt fühle ich mich langsam wieder wie die alte Ulrike.“ Da trat schon schnell eine Besserung ein. Aber bis es mir wieder richtig gut ging, hat es bestimmt ein Jahr gedauert.
Wie haben Sie aus der Depression herausgefunden?
Bei mir geschah das durch ein Zusammenwirken verschiedener Faktoren. Zum einen habe ich eine Psychotherapie gemacht. Meine Therapeutin hat mich dazu aufgefordert, hinauszugehen, was Schönes zu machen, mir die Stadt anzusehen, wieder den Blick für das Äußere zu öffnen und nicht in meinem eigenen dunklen Seelenleben stecken zu bleiben. Zum anderen waren das die Medikamente. Und ich habe im Krankenhaus angefangen zu schreiben und mir damit einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Mein ältester Sohn hat mich gefragt: „Mama, schreibst du mir eine Geschichte?“, als ob er gespürt hätte, was ich brauche. Das waren die ersten Stunden, in denen ich mich wieder heil gefühlt habe.

Ulrike Schrimpf ist Autorin und Mutter von drei Buben (2, 7 und 12 Jahre) und litt an einer postpartalen Depression.

Ulrike Schrimpf: Wie kann ich dich halten, wenn ich selbst zerbreche.
Südwest Verlag, 13,99 Euro (nur als E-Book)
Lesen Sie mehr zum Thema in der Printausgabe.
Erschienen in „Welt der Frauen“ 05/18
Fotos: Julia Grandegger, Mies Rogmans