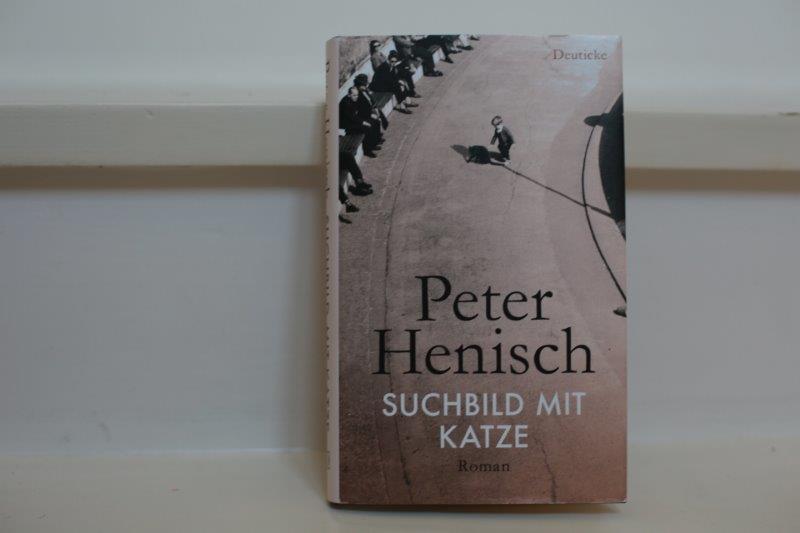Da schaut jemand aus dem Fenster und wagt es gleich auf der ersten Seite gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung, also gegen die Einbahn denken, aufwärts strömen die Gedanken, tröpfeln die Erinnerungen sanft. Und schon melden sich die Erinnerungen an ein Damals, an eine so genannte Zweizimmerwohnung für den Fenstergucker, die Katze und die Eltern. Diese Wohnung hat der Vater, ein exzellenter Fotograf, gegen einen Mantel eingetauscht: Der Vorbesitzer konnte den Tod seiner Liebsten nicht verwinden, die da in dieser Wohnung starben, weil eines der Zimmer einfach abstürzte. Unvorstellbar, ein Zimmer, weggebrochen, die Liebsten dahin. Den Mantel wiederum hat der Vater von einem riesigen Russen bekommen im Tausch gegen Fotos: Das funktionierte damals.
Die Leute da unten auf der Straße, sie ergeben ein buntes Bild, manche Männer tragen Brillen, weil sie blind sind, andere gehen auf Krücken, weil sie ein Bein verloren haben. Wie das klingt!
Der Erzähler reflektiert, wie wohl das Kind damals aus dem Fenster gesehen haben mag, was es dachte, fühlte, sich wünschte. Dachte es so kompliziert, hätte es diese Worte gewählt?
Von einem Kind, das gern eine Katze sein wollte. Das heißt, ein Kater. Denn es handelt sich um ein Kind männlichen Geschlechts. Peter. Oder soll ich den kleinen Buben, der am Fenster steht oder kniet, lieber Paul nennen? Peter oder Paul, der sich der Katze, mit der er aus dem Fenster schaut, sehr nahe fühlt. (S. 16)
Friedi, die Freundin des Buben, kommt gern bei ihm vorbei, die beiden verständigen sich von Fenster zu Fenster ohne Worte, sie haben ihre eigene Zeichensprache für ihre Verabredung. Pech, dass die Aktfotos im Vorzimmer, Meisterwerke des Vaters, das Interesse Friedis erregen: Ob sie deshalb nicht mehr kommen darf? Und da ist noch die Gasse, auf die der Bub will und vor der die Mutter ihn warnt: Willst gar ein Gassenbub werden?
Während wir mit dem Buben aus dem Fenster schauen, erfahren wir vom Erzähler, dass die eine Oma eben diese sehr kleine Frau war, die so wunderbar erzählen konnte und der er ein eigenes Buch „Eine sehr kleine Frau“ gewidmet hat. Henisch entwirft die Skizze eines Kindes, des lebensschlau aus dem Fenster blickt, geübt im Umgang mit Erwachsenen und unbeholfen im Kontakt mit Gleichaltrigen ist. Und gleich nach dieser Schilderung ein neuerlicher Bezug zu einem seiner Romane „Die Kinder, das sind die anderen“ – dieser Satz steht in einem Buch über einen gewissen „Pepi Prohaska“. Klar, da kommt noch ein Lesezeichen dazu, man solle den Pepi Prohaska und den Peter nicht verwechseln, sie seien aber literarische Verwandte.
Eins meiner Talente war eindeutig das Lesen. Ich hatte ganz einfach ein Interesse am Entziffern von Buchstaben und Freude am Umgang mit allem Geschriebenen. (S. 118)
Was Sie versäumen, wenn Sie das Buch nicht lesen: Unvorstellbar, dass Sie überhaupt erwägen, das Buch nicht zu lesen. Sie versäumen einfach alles, was das Leben so ausmacht. Vertrautheit, Sicherheit, das Schnurren einer Katze, stundenlanges Am-Fenster-Stehen, Rausschauen, Glauben und Hinterfragen, Hingabe, eine Reise durch alle Werke von Peter Henisch.
Der Autor: Jahrgang 1943, Mitbegründer der Zeitschrift „Wespennest“ prägt die österreichische Literaturszene; mit Romanen wie „Die kleine Figur meines Vater“ (1975) bis hin zu „Mortimer & Miss Molly“ (2013) lässt sich Geschichte bzw. Zeitgeschichte lesen und sogar verstehen.
Peter Henisch:
Suchbild mit Katze.
Roman.
Wien: Deuticke 2016.
203 Seiten.