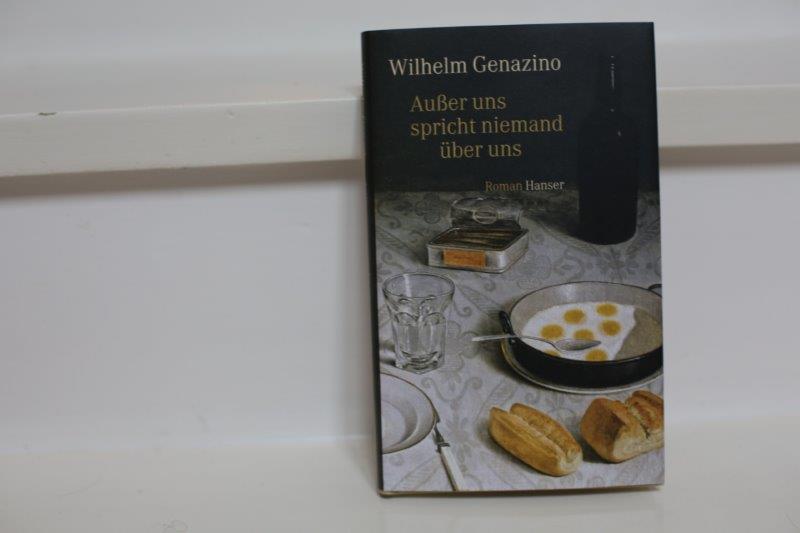Die Handlung zieht sich wie Kaugummi, der Held ist ein Antiheld und weinerlich noch dazu. Wer mehr Handlung will, kann das Buch auch gleich herschenken, mehr wird einfach nicht draus. Aber wer mit dem Ich-Erzähler durch den Alltag gleiten will, den Konjunktiv liebt und Selbstoptimierer verabscheut, erlebt Wonne: Da ist einer, mit dem Carola, die Irgendwie-Freundin, Unterwäsche kaufen geht, kaufen gehen muss. Nicht einmal das schafft er; genauso wenig ist ihm gelungen, ein gefragter Schauspieler zu werden. Nun spricht er Texte im Radio ein, das nimmt er sehr ernst, immer ein wenig böse auf die anderen, dass sie in ihm nicht das verkannte Genie erkennen. Dazwischen kauft er Semmeln, zu Deutsch Brötchen, starrt auf seinen Wecker und besucht Carola, die Irgendwie-Freundin, und deren Eltern. Natürlich, er hat den besten seiner drei Anzüge angezogen, aber auch das passt Carolas Vater nicht: Das Paar, das die biedere Tischgesellschaft ergänzt, sieht Elternfreuden entgegen. Wünscht sich Carola vielleicht auch ein Kind? Von ihm? Zimperlich mit anderen ist der Ich-Erzähler nicht, er analysiert die Tischgesellschaft, er findet passende Bezeichnungen für diverse Lokale, etwa „Rentnerlokal“, in dem Grauhaarige ihren Kaffee genießen und beim Erzähler, Reflektierer, Zauderer Unbehagen auslösen. Als sich Carola tätowieren lässt, nein, nicht nur auf der Schulter, von dem ganzen Rücken hinunter bis zur Hüfte, ahnt er, dass die Vagheit der Beziehung bald ihr Ende finden wird.
Wie immer trug sie ihr Haar offen, und wie meistens musste sie wenigstens dreimal auf die Toilette und schaltete dafür kurz die Nachttischlampe an, so dass ich mehrmals Gelegenheit hatte, im Vorüberhuschen ihren verunzierten Rücken zu betrachten. Schmerzlich veraltet erschien mir mein Wunsch nach einem bedeutsamen Leben.
Carolas Schwangerschaft verunsichert den Erzähler: Ist er wirklich der zukünftige Kindesvater? Soll er mit Carola zusammenziehen? Warum besucht Carola eine Beratungsstelle? Da zieht eine Gruppe Kindergartenkinder an ihm vorüber, die Kleinen gehen in Zweierreihen und rufen Erinnerungen an die eigene Kindheit hervor – ja, es ist die Erinnerung an eine schweißige Hand.
In diesem kurzen Text, vom Verlag doch nicht sehr trefflich mit „Roman“ untertitelt, mischt der Autor die Metaebene mit leichter Hand unter den zähen Teig des Heldenalltags. Carolas Ankündigung, sie würde bald Schluss machen mit ihm, lässt ihn nur an die adäquate Reaktion diverser Helden denken, die er immer wieder im Rundfunk einlas. Dazwischen agieren Kassiererinnen, die Treuepunkte anbieten, starke Frauen, die Mülltonnen zurechtrücken und sie lange betrachten, alte Bekannte, die schon lange im Altersheim wohnen und ihm Pommes vom Teller stibitzen. Zufälligkeiten, hier auf die kleine Bühne einer besonnenen Existenz gehoben: Der Erzähler beginnt ein Verhältnis mit Carolas Mutter – „sie beendete den Beischlaf, als würde sie irgendwo einen Stecker rausziehen“ – und kann es kaum fassen, dass er zudem ins Zahn-Ausfall-Alter eingetreten ist.
Was Sie versäumen, wenn Sie das Buch nicht lesen: Trägheit, Zitate, Selbstreflexion eines Gescheiterten, Faszination an Kleinigkeiten, bizarre Charaktere, die Eitelkeit eines Egoisten, die Abwesenheit von Spannung, Zeit für Betrachtungen und Beobachtungen, das Sich-Konzentrieren-Müssen, um den Erzählfaden zu halten, um nicht abzuschweifen und an der eigenen Bettwäsche zu riechen.
Der Autor, 1943 in Mannheim geboren, mehrfach ausgezeichneter Schriftsteller, u. a. 2004 mit dem Georg-Büchner-Preis, wird von der Literaturkritik als schreibender Flaneur bezeichnet, von den einen gefeiert und von den anderen kritisiert. Weitere Bücher von ihm „Wenn wir Tiere wären“ (2011), „Tarzan am Main“ (2013) und „Bei Regen im Saal“ (2014).
Wilhelm Genazino:
Außer uns spricht niemand über uns.
Roman.
München: Carl Hanser Verlag 2016.