Manchmal gelingt schon der erste Wurf: Bereits in jungen Jahren schrieben diese Frauen Werke, die zu Klassikern der Weltliteratur wurden.
Françoise Sagan, Carson McCullers, die Brontë-Schwestern, Mary Shelley oder Ilse Aichinger sind große weibliche Namen der Literatur, die auf den ersten Blick nicht viel außer ihrem Ruhm gemeinsam haben. Auf den zweiten verbindet sie noch etwas anderes: Alle diese Autorinnen waren sehr jung, als sie die literarische Bühne mit grandiosen Erstlingswerken betraten, und sie schufen – zum Teil noch im Teenageralter – literarische Werke von Weltrang. Sie waren allesamt junge Frauen, die sich schreibend etwas herausnahmen, was für sie in ihrer Zeit und ihrem Umfeld nicht unbedingt vorgesehen war. Carson McCullers etwa schrieb als weiße Frau über den Rassismus der US-Südstaaten. Françoise Sagan über weibliche Selbstbestimmung – lange bevor das zum Mainstream wurde –, während Ilse Aichinger nur drei Jahre nach Kriegsende die Traumata von NS-Zeit und Judenverfolgung thematisierte, als man es noch allgemein für das Beste hielt, den Mantel des kollektiven Schweigens über die jüngste Vergangenheit zu breiten.

Françoise Sagan
Mit 18 schrieb die Französin „Bonjour Tristesse“. Das Buch wurde zum Skandal und ein Welterfolg.
Es waren unerhörte Sätze aus der Feder eines Teenagers, die das konservative Nachkriegsfrankreich in Aufruhr versetzten: „Die Freiheit des Denkens, auch mal das Falsche zu denken oder weniger zu denken, die Freiheit, selbst sein Leben zu wählen, mich selbst zu wählen.“ Françoise Sagan (1935–2004) war 18 Jahre alt, als sie in nur sieben Wochen ihren Debütroman „Bonjour Tristesse“ schrieb, und 19, als er 1954 erschien. Er legte ein für alle Mal fest, wie es mit der Frau stand, die man bald „die Sagan“ nannte: Ihr „funkelndes Talent“ wurde genauso bewundert, wie man die Freiheiten kritisierte, die sich dieses „charmante Monster“ (François Mauriac) als Frau und Schriftstellerin herausnahm. Was als Skandalbuch begann, wurde zum millionenfach verkauften Bestseller, dem weitere Welterfolge wie etwa „Lieben Sie Brahms?“ folgten, flankiert von Sagans turbulentem, dramatischem Leben voller Drogen, Cocktailpartys und schneller Sportwagen. Die Hochbegabte befeuerte das Interesse an ihrer Person, indem sie pointierte Bonmots von sich gab: „Geld mag einem kein Glück kaufen, aber ich weine lieber in einem Jaguar als im Bus.“
Die Industriellentochter konnte sich ihr Jetset-Leben leisten, und in diesem Milieu spielen auch ihre Bücher. „Bonjour Tristesse“ handelt von der launischen, verspielten und blitzgescheiten 17-jährigen Cécile, die in den Sommerferien an der Côte d’Azur die beiden Geliebten ihres heiß verehrten Vaters gegeneinander ausspielt und zugleich zwischen leichtfüßiger Unbekümmertheit, erotischer Experimentierfreude, Melancholie, Trotz und Reue hin und her schwankt. Weibliche Selbstbestimmung, zumal sexuelle, ist eines der großen Themen des Buchs. Seine wechselhafte Stimmung fing den Zeitgeist ein und nahm viel von dem vorweg, was in den 1960er-Jahren folgte. Die Souveränität, mit der die blutjunge Sagan alles in Schwebe hält, beeindruckt unverändert.
 Françoise Sagan:
Françoise Sagan:
Bonjour Tristesse.
Ullstein Taschenbuch,
12,40 Euro
Ilse Aichinger
Mit ihrem einzigen Roman „Die größere Hoffnung“ schuf die 27-Jährige einen Meilenstein der Nachkriegsliteratur.
Sie habe es schon als Kind als „absurde Zumutung empfunden, dass man plötzlich vorhanden ist“, sagte Ilse Aichinger (1921–2016), die ihre „Existenz für völlig unnötig“ hielt und zeit ihres Lebens das Verschwinden einübte. In den zwei letzten Jahrzehnten ihres Lebens schrieb sie kaum noch, wanderte als kleine, zunehmend gebeugte Frau im Trenchcoat durch Wien und besuchte, solange ihr das noch möglich war, drei bis vier Filmvorstellungen pro Tag. Das Kino, wo sie in der Dunkelheit des Vorführsaals dem ersehnten Unsichtbarwerden am ehesten nahekam, war eine der Leidenschaften der großen österreichischen Schriftstellerin, die, je älter sie wurde, umso sparsamer, strenger und genauer mit Worten umging und schließlich fast vollends verstummte.
Die große Katastrophe des 20. Jahrhunderts traf Ilse Aichinger mit voller Wucht. Als Tochter einer jüdischen Ärztin überlebte die – nach Nazidiktion – „Halbarierin“ die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg in Wien, wo sie unter Lebensgefahr in einem Zimmer direkt gegenüber dem Gestapo-Hauptquartier ihre Mutter versteckte. Während ihre Zwillingsschwester Helga 1939 mit einem der letzten Kindertransporte nach Großbritannien fliehen konnte, wurden die geliebte Großmutter und die Geschwister der Mutter 1942 deportiert und ermordet.

„Gute Literatur ist mit dem Tod identisch“, sagte Aichinger. Sie interessierte sich sehr für die Seefahrt und liebte den Autor Joseph Conrad, der seine Erfahrungen als Kapitän literarisch verarbeitete, ebenso wie Franz Kafka für die Präzision seiner Sätze. Ihren Ruhm verdankt Aichinger einem ebenso schmalen wie dichten Œuvre, das größtenteils aus Kurzprosa, Skizzen, Hörspielen und kurzen Erzählungen besteht. Nur einen einzigen Roman hat sie geschrieben, ihr erstes Werk. „Die größere Hoffnung“ erschien 1948, als Aichinger 27 war, wurde jahrelang kaum rezipiert, bescherte ihr aber Ruhm in der Kollegenschaft sowie den Preis der „Gruppe 47“, die sich für die Erneuerung der deutschsprachigen Literatur nach dem Weltkriegstrauma einsetzte. Inzwischen gilt der Roman als Meilenstein der Nachkriegsliteratur. Aichingers Schriftstellerkollege Walter Jens nannte ihn „die einzige Antwort von Rang, die unsere Literatur der jüngsten Vergangenheit gegeben hat“. Der finstere Roman stemmt sich gegen das Vergessen und erzählt unter Bezug auf Aichingers eigenes Erleben von dem halbjüdischen Mädchen Ellen und anderen jüdischen Kindern im Wien der Kriegs- und Nazijahre. Doch seinen Inhalt zu erzählen, sagt wenig über sein Wesen und seine Besonderheit aus: Für Aichinger war mit der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs das herkömmliche Erzählen unmöglich geworden. Sie schuf eine neue Sprache, voller Brüche, Auslassungen und Leerstellen und unterlief ein ums andere Mal die Zusammenhänge des traditionellen Erzählens. „Die größere Hoffnung“ ist keine leichte Lektüre, ist düster und erschütternd, angesiedelt in einem kafkaesken Niemandsland, wo Leseerwartungen und -hoffnungen programmatisch nicht erfüllt werden.
 Ilse Aichinger:
Ilse Aichinger:
Die größere Hoffnung.
S. Fischer Taschenbuch,
12,40 Euro
Mary Shelley
Die 19-jährige Engländerin und das Eigenleben ihrer Schöpfung, des „Frankenstein“.
Die Idee zu ihrem Welterfolg „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“ kam der 19-jährigen Mary Shelley (1797–1851) während einer Schweiz-Reise, die sie gemeinsam mit zwei anderen früh vollendeten und skandalumwitterten Wunderkindern der englischen Literatur – Lord Byron und ihrem zukünftigen Ehemann Percy B. Shelley – unternahm. Die drei, die sich da im Regensommer 1816 in einer Villa am Genfer See die Zeit vertrieben, stellten sich die Aufgabe, jeweils eine Geschichte zu schreiben, „die auf einem übernatürlichen Ereignis beruhte“. Schauergeschichten waren groß in Mode, die Wette galt, doch sie verloren bald die Lust daran. Stattdessen setzte sich Mary Shelley hin, um einen spannenden Roman rund um ein monströses Wesen und dessen Schöpfer zu verfassen. Der Mythos, der ihr Monster umrankt, und das Eigenleben, das es seither in der Fantasie der Menschen, in Film und Kunst führte, hat seine Erfinderin ins Abseits gedrängt, und oft vergisst man sogar, dass „Frankenstein“ der Name des Schöpfers ist, nicht der des Monsters. Bei Shelley baut der junge Forscher Viktor Frankenstein aus toter Materie einen künstlichen Menschen, den er zum Leben erweckt, dessen Erscheinung ihn aber so entsetzt, dass er ihn im Stich lässt. Die menschlich fühlende Kreatur flieht quer durch die Welt und beginnt, zurückgewiesen und verzweifelt, Rache zu nehmen und sich schließlich gegen ihren Schöpfer zu wenden.
Was als Wette in Shelleys Freundeskreis begann, hat seither als Figur des Kollektivbewusstseins große Karriere gemacht und zahlreiche Sinnentstellungen erfahren, denn „Frankenstein“ erzählt vor allem von dem Versagen dabei, diejenigen, die uns äußerlich nicht ähneln, in ihrer Menschlichkeit zu erkennen. Es ist eine hochaktuelle Problematik. Der Roman erschien 1817 unter einem Pseudonym und hat die Menschheit nicht mehr losgelassen.

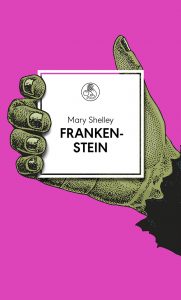
Mary Shelley:
Frankenstein
oder Der moderne Prometheus.
Manesse Verlag,
22,70 Euro
Fotos: Getty Images
Erschienen in „Welt der Frauen“ 10/2019









